„Nicht fragen, einfach machen“
Staffel 2 ist zwar vorbei – aber wir sind nicht ganz weg. In unserer Sommerpause veröffentlichen wir unregelmäßig Interviews mit Menschen, die die Erinnerungskultur entscheidend prägen. Diesmal sprechen wir mit Jürgen Wenke.
Jürgen, geboren 1957 in Bochum, ist Ingenieur, Psychologe, Psychotherapeut – und vor allem ein beharrlicher Erinnerungsarbeiter. Er hat 1980 die Schwulenberatung Rosa Strippe e.V. mitgegründet und bis 2010 geleitet. Seit Jahrzehnten recherchiert er die Geschichten homosexueller Männer, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden, und hat fast 70 Stolpersteine initiiert.
In unserem Gespräch erzählt Jürgen von seiner Motivation, von Begegnungen, die ihn geprägt haben, und von den Widerständen, die er bei der Recherche und Verlegung von Stolpersteinen immer wieder erlebt. Wir sprechen über die politische Dimension von Erinnerung, über zivilen Ungehorsam und über die Gefahren, die von rechts ausgehen.
Außerdem geht es um die Verantwortung der Gesellschaft, vergessene Opfer sichtbar zu machen, die Bedeutung von Kunst und Kultur für die Erinnerungskultur und die Frage, wie Stolpersteine zu Türöffnern werden können, um Geschichte lebendig zu halten.
Themen dieser Folge:
• Stolpersteine als Türöffner und Zeichen lebendiger Erinnerung
• Persönliche Geschichten und die Verbindung von Identität und historischer Aufarbeitung
• Widerstände und politische Gefahren für die Erinnerungskultur
• Ziviler Ungehorsam als notwendige Haltung im Engagement
• Warum Erinnerungsarbeit ein kontinuierlicher Prozess ist
• Gesellschaftliche Verantwortung: Die Vergangenheit bewahren, um die Zukunft zu gestalten
Über Jürgen Wenke:
Jürgen Wenke ist Ingenieur, Psychologe und Psychotherapeut. Er gründete 1980 die Schwulenberatung Rosa Strippe e.V. mit und leitete sie bis 2010. Heute engagiert er sich mit unermüdlicher Ausdauer für die Sichtbarmachung homosexueller NS-Opfer durch Stolpersteine und Biografien – und zeigt, wie Erinnerungsarbeit zu einem politischen Akt wird.
Shownotes & Links:
📌 Unser Podcast auf Instagram: @stolpersteineberlin.podcast
📌 Mehr zu Jürgens Arbeit: stolpersteine-homosexuelle.de
📌 Unsere Folge zu Gustav Herzberg (Staffel 1)
Fotocredit zum Folgencover: Lars Kramer
 2025/11/2356 分
2025/11/2356 分 2025/11/091 時間 20 分
2025/11/091 時間 20 分 1 時間 20 分
1 時間 20 分 23 分
23 分 41 分
41 分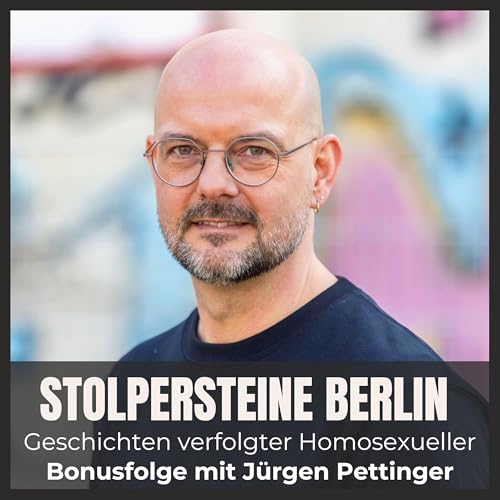 34 分
34 分 2025/06/2927 分
2025/06/2927 分 2025/06/1518 分
2025/06/1518 分
