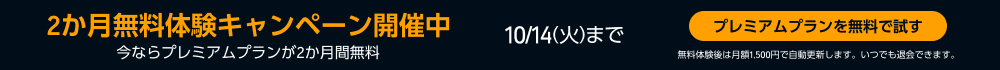Kürzlich stolperte ich über diese Liste mit "Fünf Must-Read Büchern" und diesmal ging es um "Science Fiction, empfohlen von Wissenschaftlern". Nerd, der ich bin, hatte ich vier davon schon gelesen und irgendetwas bewog mich dazu, mich der Lobpreisungen der Anne Findeisen zu erinnern und, obwohl bisher enttäuscht, sagte ich mir, gehen wir also nochmal in einen Kazuo Ishiguro rein, ich meine, der Mann ist Literaturnobelpreisträger. Der Name des empfohlenen Werkes: "Klara und die Sonne".Wie es sich (für mich) gehört, ohne das Lesen von Klappentexten, Einführungen oder gar Rezensionen, wusste ich nicht im Ansatz, worum es geht, doch mit ein bisschen Detektei war bald klar, "KF"s, wie die zunächst hauptsächlich handelnden Personen genannt werden, sind keine solche - es sind Künstliche Freunde, in einem Spezialgeschäft zum Kauf angebotene Androiden, gedacht als Begleiter für die Kinder reicher, wohlangesehener, berufstätiger Menschen.Wir verstehen, das Konzept der KFs muss eingeführt werden, wir lernen zwei Exemplare kennen, die eine etwas dumm und desinteressiert, die andere, Klara die künftige Hauptheldin, hyperaufmerksam und ungewöhnlich intelligent, wir sehen die Welt durch ihre Augen, ein enger Straßenausschnitt, ein Hochhaus, eine Baumaschine; aber die vierte Beschreibung des beschränkten Ausschnittes einer Straßenszenerie aus der Sicht der künstlich freundlichen Schaufensterpuppen ist nicht interessanter als die dritte. Wann geht's nun endlich los?Schlussendlich, ein paar dutzend Seiten im Buch, wird KF Klara gekauft, von der Mutter von Josie und es kommt leicht Fahrt in die Geschichte und damit wir hier nicht ins Spoilertrauma geraten, lassen wir diese im Buch geschehen und nicht in der Rezension und kommen zur viel, viel interessanteren Frage:Ist Herr Falschgold ein Zoni aus dem literarischen Hinterland?Man muss nicht jeden Literaturnobelpreisträger kennen und schon gar nicht jedes Preisträger Biografie studieren, aber man kann schon wissen, dass nicht jeder Schriftsteller mit einem japanischen Namen aus Japan kommt, point in case, Kazuo Ishiguro. Der wuchs in England auf und schreibt schon immer auf Englisch, was die Frage des Herrn FG nach der Ursache der seltsam schlechten Übersetzung des Romans aus dem Japanischen zunächst in eine herrlich peinliche Richtung führte. Das diskutierte er gottlob mit sich selbst und seinen verschiedenen Suchmaschinen- und AI-Chatbot-Abonnements, die ihm, wie sich das für derlei Geräte in 2025, wie für die KFs im Buch, gehört, zunächst in allen seinen Meinungen und Vorurteilen bestätigten: Ja, sagte Claude, im Japanischen gibt man Kleidungsstücken gerne einmal Eigenschaften wie "hochgestellt", was ja eher den Träger charakterisiert und das ist zweifellos schwer übersetzbar, ergo, so die KI, ein "hochgestellter Anzug" sollte nicht so genannt werden! Dass es im Deutschen die durchaus gebräuchliche Bezeichnung "vornehm", zum Beispiel bei einem Kostüm gibt, kam weder der LLM noch dem Rezensenten in den Sinn, das hätte ja die Grundannahme in Frage gestellt.Was nichts an der Tatsache ändert, dass ich mit der deutschen Übersetzung, vermeintlich aus dem Japanischen, überhaupt nicht zu Rande gekommen bin. Ja, ich schob es auf die Inkompatibilität des Japanischen zu westlichen Sprachen und hatte mich aufgrund dieser Annahme bewusst entschlossen, die deutsche Übersetzung zu lesen - warum soll man ein Buch sprachlich zweimal verschieben, einmal von der Übersetzerin und ein zweites Mal im Kopf? Aber so unlesbar war das Werk, dass ich denn doch mal die englische Version holte, um zu schauen, ob dort besser gearbeitet wurde und stoße dann auf die offensichtliche Information, dass "Barbara Schaden[..] den Roman "Klara und die Sonne" von Kazuo Ishiguro aus der englischen Sprache ins Deutsche übersetzt…" hat.Ok, da wird vieles klarer, denn das starre Subjekt-Prädikat-Objekt des Englischen und die generelle Abneigung dem Schachtelsatz gegenüber machen das vermeintlich japaneske Stakkato der Sätze erklärbarer und wenn man die dann genauso fantasielos und ohne Rücksicht auf Wortwiederholungen ins Deutsche prügelt, kommt das raus, was der Leser der deutschen Übersetzung von "Klara und die Sonne" durchleiden muss: Starre, unnatürliche Formulierungen, die grammatikalisch sicher richtig sind, aber so im Deutschen nicht gesprochen werden. Denn Kazuo Ishiguro schreibt ein seltsames Englisch. Zumindest in "Klara und die Sonne". Er scheut die Wiederholung nicht, er schreibt der Sonne ein Geschlecht zu, was im Englischen möglich, aber höchst ungewöhnlich ist (und für deutsche Ohren umso mehr, als dass diese im Englischen männlich beartikelt wird). Es werden angesprochene Personen im Satz in die dritte Person gesetzt, es werden ausgedachte Eigennamen eingeführt und bleiben unerklärt.Nachdem es mir ein paar Tage auf der Zunge lag und im Hinterkopf hin- und herschepperte, kam ich dann drauf, an welches Buch mich das Ganze erinnert: An ...
続きを読む
一部表示
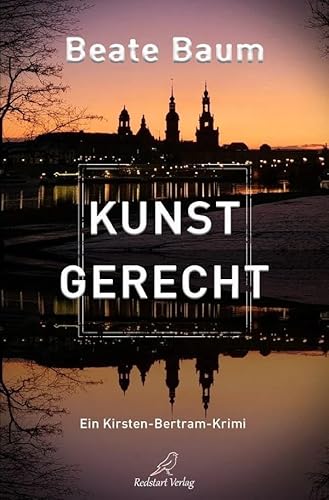 2025/09/077 分
2025/09/077 分 2025/08/319 分
2025/08/319 分 2025/08/0311 分
2025/08/0311 分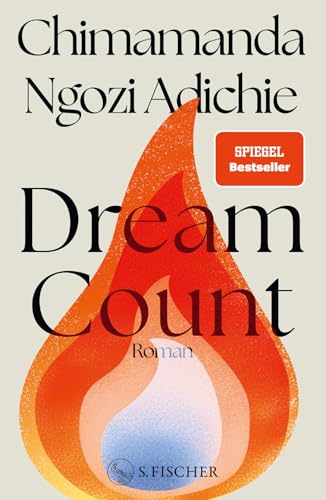 2025/07/2733 分
2025/07/2733 分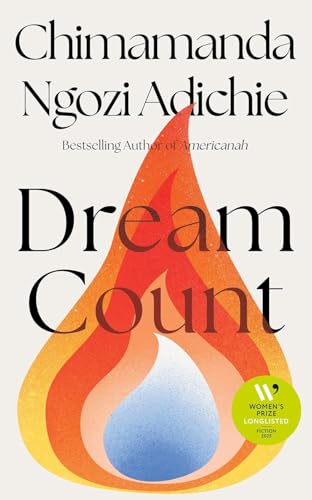 2025/07/208 分
2025/07/208 分 7 分
7 分 2025/07/069 分
2025/07/069 分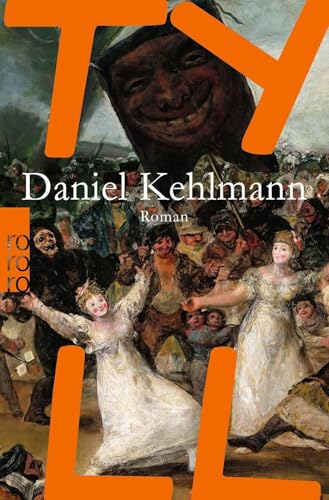 2025/06/0812 分
2025/06/0812 分